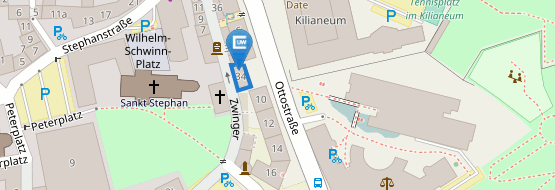Akkreditierung
Mit der Einführung eines gestuften Studiensystems mit Bachelor- und Masterstudiengängen ab den 1990er Jahren haben Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) die Einführung eines Qualitätssicherungsverfahrens für Studiengänge – die Akkreditierung – beschlossen, die im Hochschulgesetz als Verpflichtung festgeschrieben ist (Art. 7 Abs. 4 BayHIG).
Akkreditierung bedeutet das Durchlaufen eines Begutachtungsverfahrens mit Beteiligung externer Expertinnen und Experten:
Vom Akkreditierungsrat berechtigte Akkreditierungsagenturen prüfen im Auftrag der Hochschulen, ob vorgegebene Standards in Studium und Lehre eingehalten werden.
Bei der Akkreditierung unterscheidet man zwischen Programmakkreditierung und Systemakkreditierung.
Programmakkreditierung
In Bayern müssen alle Bachelor- und Masterstudiengänge einer Akkreditierung unterzogen werden (Art. 7 Abs. 4 BayHIG), bei der geprüft wird, ob ein Studiengang rechtlich, fachlich-inhaltlich und hinsichtlich seiner Berufsrelevanz vorgegebenen Standards genügt. Entsprechenden Vorgaben zufolge muss dies entweder zum Start, spätestens aber vor Ablauf der Regelstudienzeit eines neuen Studiengangs erfolgt sein. Danach müssen in achtjährigen Abständen Reakkreditierungen durchgeführt werden, bei denen die Umsetzung des Konzepts und die Weiterentwicklung des Studiengangs überprüft werden.
Programmakkreditierungen sind als Peer Review-Verfahren konzipiert, so dass die Akkreditierungsentscheidung auf dem Urteil von Professorinnen und Professoren, Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis und Studierenden mit einschlägigem fachlichen Hintergrund basiert. Dazu findet in der Regel auch eine Vor-Ort-Begehung statt.
Im Rahmen der Systemakkreditierung werden Programmakkreditierungen an der Universität Würzburg intern durchgeführt und nur in Ausnahmefällen als externe Programmakkreditierung.
Akkreditierte Studiengänge
Alle Studiengänge an der Julius-Maximilians-Universität sind akkreditiert. Die gesamte Auflistung und weitere Informationen finden Sie in dieser Übersicht.
Bitte beachten Sie, dass sich wesentliche Änderungen akkreditierter (Teil-)Studiengänge auf die Akkreditierung auswirken können. Im Falle einer solchen Änderung wird der Erhalt der Akkreditierung gemäß eines Verfahrens geprüft.
| A) Formale Kriterien | B) Fachlich-inhaltliche Kriterien |
|---|---|
|
|
Alle Bachelor- und Master-(Teil-)Studiengänge werden akkreditiert.
Kombinationsstudiengänge gelten dann als akkreditiert, wenn beide Teil-Studiengänge im Rahmen von Verfahren der Akkreditierung positiv begutachtet wurden und damit ihre Akkreditierungsfähigkeit festgestellt wurde.
Neu entwickelte (Teil-)Studiengänge werden nach dem Verfahren der Konzeptakkreditierung (s. entsprechende Verfahrensbeschreibung) akkreditiert.
Zielsetzung der Akkreditierung von Studiengängen ist es, für alle neu eingerichteten und bestehenden Bachelor- und Masterstudiengänge sicherzustellen, dass sie die Kriterien der Programmakkreditierung erfüllen. In diesem Kontext werden von der Universitätsleitung gegebenenfalls Auflagen und Empfehlungen ausgesprochen. Darüber hinaus können auch weitere universitätsspezifische Qualitätsaspekte betrachtet und diskutiert werden, zu denen die Studiengangverantwortlichen Rückmeldung bekommen.
Die Prüfverantwortung hinsichtlich der Kriterienerfüllung ist an der Universität dreigeteilt. Sowohl eine Fakultät bzw. ein Fach, externe Gutachterinnen und Gutachter als auch die mit Studiengangentwicklung befassten Bereiche der Zentralverwaltung übernehmen für bestimmte Aspekte Prüfverantwortung.
Das Qualitätsmanagement-System der Universität Würzburg sieht eine Reihe indirekter Prüfmomente der Fakultäten bzw. Fächer vor, die gewährleistet sind, wenn folgende Vorgaben umgesetzt werden:
- Betrieb des jährlichen Monitorings und des 8-Jahres-Zyklus,
- Umsetzung des QM-Rollen- und Aufgabenkonzepts und damit Organisation von Beteiligung (z. B. Studienfachkommission, Fakultätsrat, Studierende),
- Orientierung an konsensual abgestimmten Vorgaben aus der Evaluationsordnung, den Prozessbeschreibungen sowie verschiedener Handreichungen bzw. Handbücher (z. B. zu Qualifikationszielen, Studiengangentwicklung etc.),
- Lehrberichterstattung nach den dafür vorgesehenen Mustern,
- Passung von Veranstaltungen ins Zeitfenstermodell,
- Transparente Dokumentation des eigenen Vorgehens z. B. auf Webseiten.
Die Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter im Studienfachaudit ist insbesondere durch einen Frageleitfaden bestimmt, der nach den Kriterien zur Programmakkreditierung angeordnet ist. Es ist jeweils Aufgabe der begleitenden Mitarbeiterin bzw. des begleitenden Mitarbeiters aus Referat A.3, das Studienfachaudit so zu gestalten, dass im Gutachten auf alle Aspekte des Leitfadens eingegangen wird. Wenn die Gutachterinnen und Gutachter ein Kriterium als nicht erfüllt erachten, müssen sie eine passende Auflage formulieren. Hinweise, wie ein Kriterium noch besser erfüllt werden könnte oder anderweitige Vorschläge zur Weiterentwicklung eines Studiengangs, können zu Empfehlungen führen. Das Gutachten wird zur internen Akkreditierung herangezogen.
Innerhalb der Zentralverwaltung kommt den an der Studiengangentwicklung beteiligten Bereichen ihren grundsätzlichen Zuständigkeiten entsprechende Prüfverantwortung zu.
- Die Stabsstelle für studiengangbezogene Rechtsangelegenheiten prüft, ob ein Studiengang allen rechtlichen Vorgaben entspricht. Das Ergebnis dieser Prüfung fließt in den weiteren Gremienweg für die Studiengangentwicklung durch die Kommission für Studium und Lehre (KSuL) und den Senat ein.
- Durch das Referat A.1 Planung und Berichtswesen wird geprüft, ob sich ein Fach bzw. eine Fakultät einen neuen Studiengang hinsichtlich des Lehrdeputats kapazitativ leisten kann. Das Ergebnis dieser Prüfung dient insbesondere auch der Beratung der Universitätsleitung über die strategische Passung eines Studiengangs in das Angebotsprofil der Universität Würzburg.
- Das Referat A.3 Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung & Campusmanagement prüft die nicht satzungsrelevanten Qualitätsmerkmale eines Studiengangs sowie, ob ein Studiengang elektronisch abbildbar und zu verwalten ist.
Bei der Präsidialkommission für Qualität in Studium und Lehre (PfQ) laufen die Prüfprozesse bzw. deren begründete Ergebnisse für die interne Akkreditierung zusammen. Die Unterlagen dafür sind entsprechend der Kriterien zur Programmakkreditierung aufgebaut. Die Mitglieder der PfQ haben damit für ihre Beratung vollständige Übersicht darüber, ob ein Studiengang allen Anforderungen genügt.
Die PfQ hat die Möglichkeit, die von der Gutachterinnen und Gutachtergruppe und der Zentralverwaltung vorgeschlagenen Auflagen und Empfehlungen zu übernehmen, sprachlich zu verändern oder sie zu ergänzen. Wird ein Akkreditierungskriterium nicht erfüllt, muss eine Auflage ausgesprochen werden. Auflagen können nicht unmittelbar bezogen auf Finanzen oder Stellen ausgesprochen werden. Hinweise, wie ein Kriterium noch besser erfüllt werden könnte oder anderweitige Vorschläge zur Weiterentwicklung eines Studiengangs, können zu Empfehlungen führen.
Schritt 1 Bereitstellung der Unterlagen
Die PfQ bekommt die Studienfachdokumentation, zu der das Gutachten des Studienfachaudits, die Prüfunterlagen der Zentralverwaltung, die Stellungnahme des Fachs und die vorgeschlagenen Auflagen und/oder Empfehlungen gehören sowie einen vom Referat A.3 vorbereiteten Entwurf einer Beschlussempfehlung für die Universitätsleitung zwei Wochen vor dem Sitzungstermin übermittelt.
Schritt 2 Beratung in der PfQ
Die PfQ diskutiert auf der Grundlage der ihr zur Verfügung gestellten Informationen, ob der (Teil-)Studiengang die Kriterien der Programmakkreditierung erfüllt. Dabei werden die Auflagen und Empfehlungen einzeln betrachtet:
- Sind die vorgeschlagenen Auflagen und Empfehlungen richtig bzw. sinnvoll gesetzt? Sind sie verständlich und eindeutig formuliert?
- Ist eine inhaltliche Angemessenheit und Schlüssigkeit der Auflagen und Empfehlungen erkennbar?
- Möchte die PfQ begründete Auflagen oder Empfehlungen aussprechen, die nicht von der Gutachterinnen und Gutachtergruppe oder der Zentralverwaltung vorgeschlagen wurden?
- Welche Ansätze des (Teil-)Studiengangs sind womöglich positiv hervorzuheben (good practice)?
Für die Diskussion wird in die Sitzung mindestens eine Fachvertreterin oder ein Fachvertreter eingeladen. Vor der Abstimmung verlassen die Fachvertreterinnen und Fachvertreter die Sitzung. Sie werden zeitnah über den Ausgang der Akkreditierung informiert.
Die PfQ stimmt über die Beschlussempfehlung ab, die eventuell im Zuge der Diskussion abgeändert wurde.
Die möglichen Entscheidungen jeweils bezogen auf einzelne (Teil-)Studiengänge sind:
- Die Akkeditierung wird ohne Auflagen sowie mit/ohne Empfehlungen ausgesprochen.
- Die Akkreditierung wird mit Auflagen sowie mit/ohne Empfehlungen ausgesprochen.
- Eine interne Akkreditierung kann grundsätzlich versagt werden, wenn ein (Teil-)Studiengang erhebliche Mängel aufweist.
Für die Abstimmung ist die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen notwendig. Für die Sitzung entschuldigte PfQ-Mitglieder sollten nach Möglichkeit ihr Stimmrecht im Vorfeld auf ein anderes Mitglied übertragen.
PfQ-Mitglieder aus der Fakultät (auch bei Zweitmitgliedschaft) des zu behandelnden Studiengangs können an der Diskussion teilnehmen, so lange nicht der Anschein der Befangenheit besteht. Vor der Abstimmung verlassen sie den Raum, nach der Abstimmung werden sie wieder zur Sitzung zugelassen und über das Ergebnis informiert. PfQ-Mitglieder, die zugleich Studiendekanin oder Studiendekan der entsprechenden Fakultät sind, nehmen in keinem Fall an der Abstimmung teil. Von Diskussion und Abstimmung ausgenommen werden können auch PfQ-Mitglieder, die einer anderen Fakultät angehören, wenn sie sich selbst für befangen erklären. PfQ-Mitglieder werden verpflichtet Tatsachen und Umstände, die den Anschein der Befangenheit begründen könnten, der PfQ mitzuteilen. Im Zweifelsfall entscheidet die PfQ unter Ausschluss des betroffenen Mitglieds oder der betroffenen Mitglieder, ob Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit begründen könnten.
Schritt 3 Beschluss der Universitätsleitung
Die oder der PfQ-Vorsitzende – oder im Falle der Befangenheit die Stellvertretung – spricht die Akkreditierung im Auftrag der Universitätsleitung auf der Grundlage der Beschlussempfehlung der PfQ aus.
Eine Akkreditierung wird – auch im Falle von Auflagen – in der Regel für acht Jahre ausgesprochen. Auflagen müssen in der Regel innerhalb von neun Monaten erfüllt werden. Der Zeitraum kann jedoch in begründeten Fällen verlängert oder verkürzt werden.
Falls die bzw. der Vorsitzende von der Beschlussempfehlung der PfQ abweichen möchte, wird die Abweichung mit der Universitätsleitung besprochen. Die PfQ wird über das Ergebnis einer solchen Rücksprache zeitnah informiert.
Wird ein (Teil-)Studiengang trotz eventuellen Aussetzens des Verfahrens und Fristverlängerung nicht akkreditiert, wird der Prozess „Studiengang aufheben“ ausgelöst.
Schritt 4 Nachbereitung
Die oder der PfQ-Vorsitzende übermittelt über Referat A.3 der Fakultät (adressiert an Dekanin oder Dekan, Studiendekanin oder Studiendekan, Studienfachverantwortliche oder Studienfachverantwortlichen, Studiengangskoordinatorin oder Studiengangskoordinator sowie die studentischen Vertreterinnen und Vertreter im Fakultätsrat) die offizielle Akkreditierungsentscheidung. Das Schreiben geht nachrichtlich an die am Prüfprozess beteiligten Stellen. Das Referat A.3 sorgt für den entsprechenden Eintrag eines (Teil-)Studiengangs in WueStudy sowie in die Datenbank akkreditierter Studiengänge des Akkreditierungsrates und benachrichtigt das zuständige Staatsministerium über die Akkreditierung.
Schritt 5 Auflagenerfüllung
Unterlagen zur Auflagenerfüllung sendet eine Fakultät bzw. ein Fach über die Studiendekanin oder den Studiendekan an das Referat A.3, das eine erste Sichtung und Einschätzung vornimmt. Die PfQ berät über die Auflagenerfüllung und spricht eine an die Universitätsleitung gerichtete Beschlussempfehlung aus. Kommt eine Fakultät der Auflagenerfüllung nicht nach, entscheidet die Universitätsleitung auf Beschlussempfehlung der PfQ über die Entziehung der Akkreditierung des (Teil-)Studiengangs.
Ein neu entwickelter Studiengang wird i. d. R. akkreditiert, bevor er an den Start geht, sofern nicht innerhalb des Zeitraums der Regelstudienzeit des neuen Studiengangs ein Studienfachaudit und eine Akkreditierung für das Fach vorgesehen sind.
In diesem Falle spricht man von einer Konzeptakkreditierung.
Die Akkreditierungsfrist richtet sich dabei nach derjenigen des entsprechenden Fachbündels, damit einheitliche Fristen bestehen bleiben und der universitäre Gesamtplan eingehalten wird.
Näheres ist in der Verfahrensbeschreibung für die Konzeptakkreditierung geregelt.
Systemakkreditierung
In diesem Verfahren wird das gesamte Qualitätssicherungssystem einer Hochschule im Bereich Studium und Lehre begutachtet. Es wird geprüft, ob die Hochschule selbst in der Lage ist, die Qualität ihrer Studiengänge gemäß international anerkannter Standards zu gewährleisten. Zulassungsvoraussetzung für die Systemakkreditierung ist ein funktionierendes, d. h. tatsächlich gelebtes, universitätsweites QM-System für Studium und Lehre.
Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg ist seit dem 19. März 2018 systemakkreditiert
(Gutachten zur Systemakkreditierung 2018). Am 4. Dezember 2025 wurde die Universität ohne Auflagen reakkreditiert
(Akkreditierungsbericht zur Systemreakkreditierung 2025). Damit darf die Universität die von ihr angebotenene Studiengänge unter Beteiligung externer Expertinnen und Experten weiterhin selbst akkreditieren.
Kriterien der Systemakkreditierung
- Konzept des Qualitätsmanagementsystems (Ziele, Prozesse, Insturmente)
- Leitbild für die Lehre
- Systematische Umsetzung der Kriterien auf Studiengangsebene
- Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten udn Verantwortlichkeiten
- Einbeziehung von internen Mitgliedsgruppen und externem Sachverstand
- Unabhängigkeit von Qualitätsbewertungen
- Leistungsbereiche und Ressourcenaussatttung
- Wirkung und Weiterentwicklung
- Maßnahmen zur Umsetzung des Qualitätsmanagmentkonzeptes
- regelmäßige Bewertung der Studiengänge
- reglementierte Studiengänge
- Datenerhebung
- Dokumentation und Veröffentlichung
- Hochschulische Kooperationen
- Kooperationen auf Studiengangsebene
Erfahren Sie mehr über die Kriterien für die Systemakkreditierung