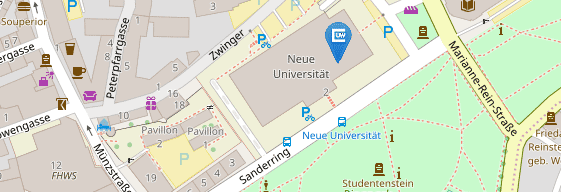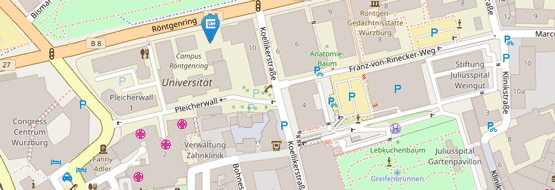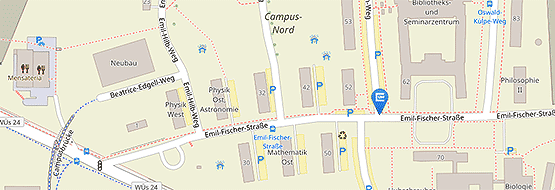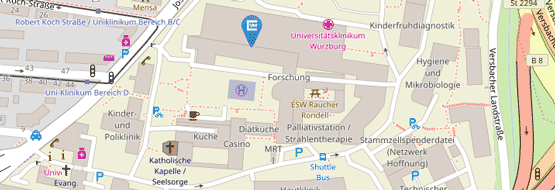Ohne Maximalforderungen zum Erfolg
09.05.2017Laut bayerischem Hochschulgesetz muss jede Uni einen Beauftragten für Studierende mit Behinderung bestellen. In Würzburg hatte Reinhard Lelgemann dieses Amt zwölf Jahre lang inne. Jetzt hat er seinen Abschied genommen.

Professor Reinhard Lelgemann hat an der Universität Würzburg den Lehrstuhl für Sonderpädagogik II – Körperbehindertenpädagogik inne. Zum Jahreswechsel 2004/2005 hatte er das Amt als Beauftragter der Universitätsleitung für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung übernommen. Ende März 2017 hat er diese Tätigkeit beendet. Sein Nachfolger ist Privatdozent Dr. Olaf Hoos, wissenschaftlicher Leiter des Sportzentrums der Uni.
Die Pressestelle der Uni hat mit Reinhard Lelgemann über seine Erfahrungen aus dieser mehr als zwölf Jahre dauernden Aufgabe gesprochen.
Herr Professor Lelgemann: Warum haben Sie das Amt des Beauftragten der Universitätsleitung für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung übernommen? Ich bin ja Professor für Körperbehindertenpädagogik und habe mich schon immer für die Frage interessiert, wie Menschen mit einer Behinderung ihr Bildungsrecht nutzen können. Als ich im Frühjahr 2003 an die Uni Würzburg kam, wollte ich erfahren, wie körperbehinderte und im Weiteren behinderte Studierende hier begleitet werden. Und da hatte ich den Eindruck, dass dies strukturell besser abgesichert werden könnte.
Wie war denn die Situation, bevor Sie das Amt übernahmen? Es gab natürlich auch schon einen Beauftragten, der damals aus der Verwaltung kam. Es handelte sich um einen Mitarbeiter aus der Studienberatung, der sich sehr engagiert um das Thema gekümmert hat. Er stand aber kurz vor dem Ruhestand und hatte auch nichts dagegen, das Amt an eine andere Person abzugeben.
Was verstehen Sie unter „strukturell besser abgesichert“? Es war einfach klar, dass das Amt anders verankert sein musste, damit man nicht nur persönlich beraten, sondern auch Entwicklungen, beispielsweise im Bereich des Prüfungsrechts oder der Barrierefreiheit anstoßen konnte. Das Amt des Beauftragten musste dafür an der richtigen Stelle in der Hierarchie der Universität positioniert sein. Es war nun einmal leider so, dass man als Professor mehr umsetzen konnte, verglichen mit einem Mitarbeiter aus der Verwaltung. Und der damalige Präsident, Professor Haase, stand diesem Vorschlag aufgeschlossen gegenüber.
Und wie gestalteten sich Ihre Anfänge als neuer Beauftragter? Der Einstieg war sehr anspruchsvoll. Nachdem ich eine Homepage eingerichtet hatte, haben sich viele Studierende bei mir gemeldet. Die individuelle Beratung hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, und ich musste anfangs viele Gespräche mit Dozenten führen.
Worum ging es in diesen Gesprächen? Fast immer um Fragen des Nachteilsausgleichs. Viele Dozenten hatten damals die Sorge, sie müssten den betroffenen Studierenden einen Vorteil verschaffen. Es ging und geht aber nicht um Begünstigungen oder Vorteile. Es geht darum, Menschen, die begabt sind, eine Chance zu geben, ihre Fähigkeiten zu entfalten und zu zeigen. Es geht darum, Erschwernisse zu minimieren.
Waren denn die Probleme von Studierenden mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung den Uni-Mitarbeitern bewusst? Nicht in allen Bereichen. Das Thema „Behinderung“ ist ja ein schwer greifbares Thema. Denn nur wenige der Betroffenen sind offensichtlich körperbehindert. In einer Vielzahl der Anfragen handelt es sich um psychische Erkrankungen, die man nicht sehen kann. Und die wenigsten outen sich – weshalb es auch kaum Unterstützung untereinander gibt. Deshalb müssen wir das Thema auch immer wieder ins Gedächtnis rufen und dafür sensibilisieren.
Diskussionen zum Nachteilsausgleich waren aber nicht Ihre alleinige Aufgabe – oder? Nein, ich habe beispielsweise auch viel Zeit damit verbracht, Baupläne zu studieren und zu kontrollieren, ob bei Neubauten der Uni die Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt wurden. Zeitweise lag mein ganzes Büro voll mit diesen Plänen.
Das klingt nach einem ziemlich zeitaufwändigen Amt. Das war es in der Tat, und ich habe auch recht bald feststellen müssen, dass es sich auf Dauer kaum mit meinen eigentlichen Aufgaben als Professor würde vereinbaren lassen. Dann hat Bayern zum Glück Studienbeiträge eingeführt.
Zum Glück? Ja, für mich zum Glück. Studienbeiträge waren meine Rettung. Ich habe gleich die Chance ergriffen und eine Vollzeitstelle und ein Büro beantragt für die Beratung von Studierenden, weil mir klar war, dass ich diese Aufgabe nicht alleine in dem Ausmaß würde betreiben können, wie es erforderlich war. Mein Antrag wurde dankenswerterweise von allen Gremien unterstützt, und so kam es sehr schnell zur Gründung von KIS – der Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung – mit Mechthild Klostermann als erster Leiterin. Sie hat die Strukturen entwickelt und abgesichert; ihre Nachfolgerin, Frau Mölter, hat neue inhaltliche Ideen mitgebracht und umgesetzt. Und ich als Professor habe meine Möglichkeiten genutzt, das Amt abzusichern. Darüber hinaus habe ich versucht, das Thema bayernweit voranzubringen.
Was heißt das konkret: „bayernweit voranbringen“? Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften konnten wir beispielsweise im Jahr 2011 den bayerischen Arbeitskreis der Beauftragten gründen, der sich seitdem zweimal im Jahr an wechselnden Orten trifft und dem Erfahrungsaustausch sowie der Fortbildung dient.
Forschung ist auch ein Thema für den Beauftragten – nicht nur Beratung? Definitiv! Und auch in diesem Bereich war unser Engagement erfolgreich: Zum Ende meiner Tätigkeit ist es uns gelungen, einen Forschungs- und Praxisverbund Inklusion an Hochschulen gemeinsam mit der Universität Bayreuth und weiteren Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu realisieren. Ziel ist es, Bedingungen und Perspektiven eines Studiums mit Behinderung und chronischer Erkrankung qualitativ und vor allem strukturell weiter zu erforschen und zu entwickeln. Damit sind deutliche Perspektiven einer Professionalisierung der Arbeit realisierbar.
Also waren Ihre zwölf Jahre eine Erfolgsgeschichte? Wirkliche Misserfolge habe ich in dieser Zeit nicht erlebt. Das lag sicherlich auch daran, dass wir eine realistische Vorgehensweise eingeschlagen und keine Maximalforderungen gestellt haben. Außerdem hatten wir immer die Unterstützung der Hochschulleitung für unsere Vorhaben. Beide Präsidenten und insbesondere unser Kanzler Dr. Klug hatten und haben immer ein offenes Ohr für uns und haben uns immer unterstützt.
Hat sich denn in dieser Zeit etwas verändert im Umgang mit dem Thema? Im Vergleich zu früher müssen wir heute keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Es gibt nicht mehr die Angst, dass wir den Studierenden Vorteile verschaffen wollen. Heute zeigen sich die meisten Kollegen zum Beispiel offen für den Nachteilsausgleich.
Und wie sehen Ihre Wünsche für die Zukunft von KIS aus? Dementsprechend sind meine Wünsche für die Zukunft vergleichsweise einfach: Das Angebot der Universität Würzburg soll erhalten bleiben – und an jeder Universität und Hochschule in Bayern zum Standard werden. Im Detail kann man dann über vieles diskutieren. Zudem wünsche ich meinem Nachfolger, Herrn Dr. Hoos und Frau Mölter für die kommenden Jahre viel Erfolg für die weitere Arbeit.
Vielen Dank für das Gespräch.