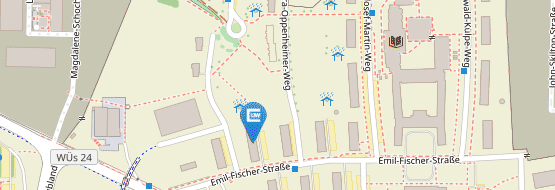Stadt-Land-Boden. Verbindende Bodenpolitik zwischen Stadt und Land
| Datum: | 24.10.2025, 09:00 - 16:00 Uhr |
| Kategorie: | Demokratie & soziale Gerechtigkeit, Zertifikat Interkulturelle Kompetenz, Zertifikat Nachhaltigkeit & globale Verantwortung, B, Workshops |
| Vortragende: | Verschiedene |
Workshops zur Buchveröffentlichung "Stadt-Land-Boden. Verbindende Bodenpolitik zwischen Stadt und Land"
9:00 - 9.30 Uhr
Begrüßung und Eröffnung
9.30 - 11:00 Uhr
Panel 1 – Entkapitalisierung von Boden
In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1967 heißt es: „Die Tatsache, daß der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen; eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern.“. Dennoch sehen sich Menschen in der Stadt und auf dem Land (bzw. in der Landwirtschaft) zunehmend mit dem Problem konfrontiert, dass Böden vermehrt als Kapitalanlagen genutzt werden.
Eine Reihe von Beiträgen im Sammelband "Stadt-Land-Boden" widmen sich den sozialen und ökologischen Konsequenzen dieser Entwicklung, und stellen Instrumente vor, mit denen sich Böden und ihre Nutzung entkapitalisieren lassen. Wie kann es gelingen, Land und Boden dauerhaft der rein gewinnorientierten Verwertung zu entziehen und eine gemeinwohlorientierte Nutzung zu befördern? In
diesem Panel nehmen wir die Übergabe von Land im Zusammenhang mit Betriebsnachfolgen und Vererbungen in den Blick. Diese bergen einerseits die Gefahr, Machtkonzentration und gewinnorientierte Verwertung zu befördern. Andererseits könnten Momente des Übergangs auch als Chance begriffen werden. Könnte das Erbrecht so umgestaltet werden, dass Flächen und Immobilien, die von den Eigentümer*innen nicht selbst bewirtschaftet oder bewohnt werden, im Erbfall von Siedlungsgesellschaften oder Gemeinden erworben werden können? Wäre es denkbar, dass der Erbfall ein Kaufrecht von Kommunen, Bewohnenden oder gemeinnützigen Institutionen wie Community Land Trusts auslöst? Wie kann verhindert werden, dass infolge fehlender Hofnachfolge immer mehr Land an orts- und landwirtschaftsfremde Investoren übergeht? Was sind Möglichkeiten für die Nachfolge flächenmäßig großer Agrargenossenschaften in Ostdeutschland, für die angesichts hoher Bodenpreise aktuell nur finanzstarke Investoren als Käufer in Frage kommen?
Bestätigte Speaker*innen: Prof. Dr. Dirk Löhr (Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Hochschule Trier), Dr. Sabine Horlitz (Vorstandsvorsitzende Stadtbodenstiftung), Tobias Bernet (Geschäftsführer Wohnbund e.V.), Christian Jundt (Landwirt, Patersberghof), Stephanie Wild (Kulturlandgenossenschaft)
11.00 - 11.30 Uhr
Kaffeepause
11:30 - 13:00 Uhr
Panel 2 – Flächennutzungskonflikte, gerechte Verteilung und Bodenökologie
Viele Beiträge des Sammelbandes "Stadt-Land-Boden" verdeutlichen: In Zeiten einer globalen Polykrise ist die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Flächennutzungsfragen nicht zu unterschätzen. Wie wir mit dem Boden umgehen, ist zukunftsweisend. Der Erhalt von fruchtbaren Böden und seiner landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ist wesentlich für das Gemeinwohl. Städte müssen möglichst nach innen entwickelt werden,, um das Ökosystem Boden vor weiterer Versiegelung zu schützen. Das deutsche Baugesetzbuch betont dies schon seit über 30 Jahren in der sogenannten Bodenschutzklausel. Dennoch wird dieser Belang in der kommunalen Bauleitplanung regelmäßig – dem nationalen wie auf EU-Ebene geltenden Flächensparziel entgegen – weniger stark gewichtet als andere Belange. Der Entwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung“ von 2024 hatte einiges an Potenzial, der fortschreitenden Versiegelung entgegenzuwirken. So griff er etwa einige Prämissen der Neuen Leipzig Charta auf, die auch als das Leitdokument für eine gemeinwohlorientierte Entwicklung von europäischen Städten bezeichnet wird. Unter anderem sah der Entwurf die Förderung der Strategie der dreifachen Innenentwicklung vor, mit deren Umsetzung zaghafte Schritte hin zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel in der deutschen Stadt- und Bodenpolitik hätten gemacht werden können. Von den Potenzialen dieses Entwurfs ist der im Juni 2025 vom Bundeskabinett beschlossene und im parlamentarischen Verfahren befindliche sogenannte „Bauturbo“ (die Neueinführung eines §246e BauGB-E) weit entfernt und in der vorliegenden Fassung vielmehr prädestiniert, Bodenspekulationen sowie Klimarisiken und Umweltschäden zu verschärfen. Umso mehr sind jetzt die seit Jahren aktiven unterschiedlichen Akteure im urbanen, suburbanen und ländlichen Raum gefragt, sich zu vernetzen.
Das Panel behandelt unter anderem folgende Fragen: Benötigen wir die Einführung verbindlicher Flächenkontingente für Kommunen? Wie gelingen koproduktive Stadtumgestaltungen, Mehrfach- und Umnutzungen von Leerstand und Verkehrsflächen sowie das Schaffen von agri-urbanen Quartieren? Braucht es Suffizienzkriterien? Wie können Versuche in der Agrarpolitik, ökologische Zielsetzungen mit der Förderung von Landwirtschaft zu vereinen, vorangebracht werden? Wie kann eine bessere Vertretung von kleinen und mittleren Betrieben gelingen? Wie entstehen Stadt-Land-Bündnisse zur Verteidigung von Natur und Agrarland gegen Versiegelung und Umnutzung? Mit den richtigen rechtspolitischen Strategien und institutionellen Arrangements könnte der Boden das sein, was eine Gesellschaft zusammenhält statt spaltet.
Bestätigte Speaker*innen: Prof. Dr. Laura Calbet Elias (Professorin für Theorien und Methoden der Stadtplanung am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart), Martin Schäfer (AbL/ Volksbegehren gegen Flächenfraß BaWü), Prof. Dr. Theo Kötter (Professur für Städtebau und Bodenordnung der Universität Bonn), Mia Sulzbach (Bündnis Bodenwende)
13:00 - 14:00 Uhr
Mittagspause
14:00 - 14:30 Uhr
Law Clinic Transformationsrecht
Vorstellung der Ergebnisse der Law Clinic zu Liegenschaften der Universität und ihrer gemeinwohlorientierten Nutzung
14:30 - 16:00 Uhr
Werkstattgespräch mit Initiativen und Ausklang
Mit u.a. Friederike Habermann vom NOW-Net, Hanna Noller vom Stadtlücken e.V., Julia Bar-Tal von Bäuer*innen ohne Grenzen und Martina Demitrieff zur Bürgerinitiative „Kein Industriegebiet zwischen Wiedemar – Brehna – Delitzsch“ und Annabella Jakab (Berliner Stadtgüter)
Anmeldung per Mail an jura-p-oerecht@uni-wuerzburg.de erforderlich.
Anrechenbar für GSiK für die Zusatzqualifikation "Interkulturelle Kompetenz" im Bereich B sowie für die Zusatzqualifikation "Nachhaltigkeit und globale Verantwortung".
Zurück