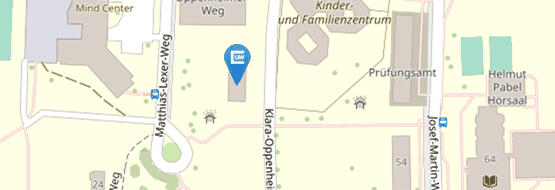Mentale und körperliche Gesundheit
Die Julius-Maximilians-Universität (JMU) bekennt sich in ihrem Leitbild und der Inklusionsvereinbarung zu Chancengleichheit und Vielfalt. Deshalb hat die JMU es sich zum Ziel gemacht, Studierenden und Beschäftigten mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen einen möglichst barrierefreien Zugang zu Studium, Forschung und Beruf zu eröffnen. Hierfür hält die JMU folgende Beratungs- und Unterstützungsangebote bereit:
Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung (KIS)
Die KIS wirkt seit 2008 zentral an der Verbesserung der Situation von Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Mit einem so breiten wie spezialisierten Angebot hat die KIS schon früh eine Vorreiterrolle in der Bayerischen Hochschullandschaft eingenommen und sich seither als vorbildhafte Einrichtung im Bereich der Inklusion an Hochschulen etabliert. Neben Studieninteressierten, Studierenden und Promovierenden ohne Arbeitsvertrag finden hier auch die Lehrenden der JMU sowie die Mitarbeitenden der Zentralverwaltung Rat und Unterstützung.
Schwerbehindertenvertretung
Die Schwerbehindertenvertretung ist für alle Belange der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten der JMU zuständig und vertritt deren Interessen gegenüber der Dienststelle. Ihnen stehen auf Wunsch die Vertrauensperson der schwerbehinderten Beschäftigten bzw. deren
Stellvertretungen zur Seite, um Unterstützung im Arbeitsalltag und Beratung in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten zu erhalten.
Gesunde Hochschule
In Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren hat die JMU ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement für alle Angehörigen aufgebaut. Ziel der Gesunden Hochschule ist es, eine lebendige und vielseitige Gesundheitskultur zu schaffen, indem sie auf die
Studier- und Arbeitsbedingungen an der JMU positiv einwirkt und diese laufend weiterentwickelt. Über eine Vielzahl gesundheitsfördernder Maßnahmen und Angebote erhalten die JMU-Angehörigen die Gelegenheit, ihre persönliche Gesundheitskompetenz entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten, Bedürfnisse und Interessen zu erweitern.
Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung
Geschlecht
Es wird oft das binäre Geschlechtersystem, Mann und Frau, vorausgesetzt. Unabhängig davon, von welchem Geschlechtersystem ausgegangen wird, Geschlecht ist immer auch sozial konstruiert. Aus dem sogenannten Gender leiten wir unsere Geschlechterrollen und -stereotype ab.
Die Diskriminierungsform des Sexismus aber auch sexuelle Belästigung wird mit der Diversitätsdimension in Verbindung gebracht. Zentral ist dabei nicht das tatsächliche Geschlecht einer Person, sondern welches ihr von außen zugeschrieben wird, also als welches sie gelesen wird.
Geschlechtsidentität
Der Begriff der Geschlechtsidentität beschreibt das subjektive Empfinden eines Menschen, dem männlichen, weiblichen oder einem dritten Geschlecht anzugehören oder zwischen den Geschlechtern zu stehen. Die Geschlechtsidentität kann vom biologischen Geschlecht und von der gesellschaftlich zugewiesenen Geschlechterrolle abweichen.
Quelle: https://www.bmz.de/de/service/lexikon/geschlechtsidentitaet-57492
Diskriminierung erfahren oft Personen, deren Geschlechtsidentität nicht oder nicht vollständig mit ihrem von der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen. Transpersonen sind oft Transfeindlichkeit ausgesetzt.
Sexuelle Orientierung
Die sexuelle Orientierung beschreibt zu welchem Geschlecht oder welchen Geschlechtern sich Menschen hingezogen fühlen. Diese Anziehung kann emotional, körperlich und/oder sexuell sein.
Quelle: https://queer-lexikon.net/2017/06/08/sexuelle-orientierung/
Homo- und bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen werden oft unter der Bezeichnung LSBTIQ* zusammengefasst. LSBTIQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*, inter* und queere Personen. Das Sternchen* steht stellvertretend für weitere Identitäten.
Wenn Personen entgegen der vorherrschenden Heteronormativität queer sind, können sie Queerfeindlichkeit ausgesetzt sein.
Anfeindungen und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung können aus dem universitären sowie aus dem familiären Umfeld belastend für Betroffene sein.
Lebensalter
Die Diversitätsdimension Alter bezieht sich auf Lebensumstände, die im Zusammenhang mit dem Lebensalter stehen. Während das Alter bisher nicht ausdrücklich in den Gleichbehandlungskatalog des Art. 3 im Grundgesetz (1949) aufgenommen wurde, ist es als unzulässiges Diskriminierungsmerkmal im Art. 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000) verankert und gehört auch zu den durch das Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (2006) geschützten Merkmalen.
Neben dem biologischen Alter geht es im Kontext der JMU auch um verschiedene Lebensphasen an einer Universität: Erstsemester befinden sich in einer anderen Phase als Post-Docs, neu eingestellte Absolvent:innen arbeiten mit 20 Jahre älteren Kolleg:innen zusammen. (…)
Die JMU zielt auf den Schutz und die Förderung all ihrer Angehörigen ungeachtet der Lebensphase, in der sie sich befinden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Altersgruppen, die von struktureller Ausgrenzung und Benachteiligung betroffen sind. Spezifisch für ältere Menschen ist eine Teilhabe an Studium, Forschung und Beruf im universitären Umfeld häufig mit sachlich oder historisch begründeten Hürden verbunden. So gelten in Bayern z.B. bestimmte Höchstaltersgrenzen für die Beteiligung am Zentralen Vergabeverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge oder auch für die Berufung von Beschäftigten der Universität in das Beamtenverhältnis. Im Zuge gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse wie dem demografischen Wandel können und müssen solche Ausschlussmechanismen jedoch immer wieder neu verhandelt werden. Das gilt auch für weniger greifbare Formen der altersbedingten Abwertung von Menschen, wie sie sich z.B. in verbreiteten Einstellungen äußert, etwa in der Vorverurteilung junger Studierender als „unzuverlässig“ oder älterer Kolleg:innen als „konservativ“.
Die JMU strebt danach, altersbezogene Benachteiligungen für ihre Angehörigen abzubauen bzw. alters- und alternsgerechte Strukturen zu schaffen, wo immer dies möglich ist. Hierzu gehört z.B. die Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle (ab [Monat] 2024) und das Beratungs- und Unterstützungsangebot des Familienservice. Da sowohl der Anteil der Studierenden mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen als auch der Anteil schwerbehinderter Beschäftigter mit steigendem Alter kontinuierlich wächst, sind universitätseigene Angebote wie das der KIS und der Gesunden Hochschule zunehmend auch für altersbezogene Herausforderungen gerüstet. Neben einem defizitorientierten Ausgleich investiert die JMU aber auch in die kompetenzorientierte Nutzung und Förderung der Vorteile, die eine breite Altersstreuung innerhalb ihrer Studierenden- und Belegschaft mit sich bringt. Lernangebote im Rahmen eines Frühstudiums oder Senior:innenstudiums z.B. dienen nicht nur dem persönlichen Erkenntnisgewinn, sondern erweitern auch das Spektrum unserer Wissensgesellschaft, die auf keine Perspektive verzichten kann.
Soziale Herkunft
Soziale Herkunft und die dadurch einhergehende Ungleichheit ist ein zentrales Thema unserer Gesellschaft und beeinflusst viele Aspekte unseres täglichen Lebens – von Bildungschancen über den Zugang zum Arbeitsmarkt bis hin zu gesundheitlichen Ressourcen. Sie wirkt sich auf die Lebensqualität aus und prägt die Möglichkeiten, die jedem Einzelnen zur Verfügung stehen, um sich zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Unser Ziel an der Julius-Maximilians-Universität (JMU) ist es, die Bewusstseinsbildung zu fördern, Chancengleichheit zu unterstützen und zur Reduzierung von sozialer Ungleichheit beizutragen.
Was ist soziale Ungleichheit?
Soziale Ungleichheit beschreibt die ungleiche Verteilung von Ressourcen und Chancen innerhalb einer Gesellschaft, wie Einkommen, Bildung, Gesundheitsversorgung und politischen Einflussmöglichkeiten, die oft in historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen begründet sind. Diese Ungleichheit ist problematisch, da sie den sozialen Zusammenhalt und die Stabilität einer Gesellschaft gefährden kann. Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen oder keine fairen Chancen sehen, erleben häufig Unzufriedenheit, Isolation oder soziale, bzw. gesellschaftliche Spannungen. Besonders besorgniserregend ist, dass die Ungleichheit oft von Generation zu Generation weitergegeben wird, was es sozial benachteiligten Menschen erschwert, ihre Lage aus eigener Kraft zu verbessern.
Formen und Ursachen
Soziale Ungleichheit zeigt sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens:
- Bildung: Der Bildungsweg eines Menschen ist stark von seiner sozialen Herkunft geprägt. Kinder aus einkommensschwachen und/oder Nichtakademiker-Familien haben oft schlechtere Startbedingungen, geringere Unterstützungsmöglichkeiten im schulischen Bereich und weniger Zugang zu höherer Bildung.
- Einkommen und Beschäftigung: Der Arbeitsmarkt ist ein weiterer Bereich, in dem die soziale Ungleichheit ihre Konsequenzen hat. Menschen mit niedrigem Bildungsniveau oder aus benachteiligten sozialen und familiären Gruppen haben geringere Chancen auf gut bezahlte Arbeitsplätze und sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen.
- Gesundheit: Soziale Herkunft beeinflusst auch die Gesundheit. Personen aus benachteiligten sozialen Schichten haben in der Regel einen schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung und leiden häufiger unter gesundheitlichen Problemen.
- Geschlecht und Diversität: Auch Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung und andere persönliche Merkmale spielen eine Rolle bei der Verteilung von Ressourcen und Chancen. Diskriminierung und Vorurteile tragen zur Verstärkung sozialer Ungleichheit bei.
Die Ursachen für soziale Ungleichheit sind vielschichtig und können sowohl in der individuellen Ebene als auch in gesellschaftlichen Strukturen verortet werden. Dazu zählen wirtschaftliche Veränderungen, Globalisierung, technologische Entwicklungen, aber auch gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen.
Was tun?
Die Reduzierung sozialer Ungleichheit erfordert gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft. Bildung spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da sie die Grundlage für eine selbstbestimmte Lebensführung und sozialen Aufstieg bildet. Gleichermaßen wichtig sind Maßnahmen, die den Zugang zu Gesundheitsversorgung verbessern, Diskriminierung abbauen und faire Arbeitsbedingungen fördern.
Die JMU versteht sich als ein Ort, an dem Chancengleichheit und Inklusion gefördert werden. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Studierende und Mitarbeitende– unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Merkmalen – die gleichen Chancen auf Teilhabe und Erfolg haben. Dies erreichen wir durch eine Vielfalt an Programmen, Beratungsangeboten und Initiativen, die die soziale Gerechtigkeit auf dem Campus stärken sollen.
Wissenschaft international und interkulturell
Zur Stärkung der JMU als international vernetzte Universität soll die Willkommenskultur auf allen Karrierestufen weiter ausgebaut werden, wodurch nach außen auch die internationale
Reputation der Universität als Studien- und Arbeitsumfeld gesteigert wird. Ein erstes großes Ziel hierbei ist die grundlegende Überarbeitung der Internationalisierungsstrategie, in deren
Zuge der Aufbau eines Kerndatensatzes Internationalisierung erfolgen soll. Die Fertigstellung der Strategie ist bis Ende 2023 geplant; die Ergebnisse der partizipativen Workshops im Rahmen des Auditprozesses fließen in das Strategiekonzept Internationalisierung ein.